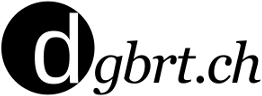2021
Was ich weiss. Was mich ratlos macht
Sonntag, 2021-11-28 | 23:25:03 CET
Was ich inzwischen gelernt habe? Was eine effektive Reproduktionszahl ist. Ein PCR-Test, ein Spike-Protein. Wie Inzidenz definiert ist, oder 2G-, 2G Plus- oder 3G-Regeln. Was mRNA so etwa ist und wie mRNA-Impfstoffe so etwa wirken. Was FFP2-Masken sind und wie man sie benutzt. Wie unterschiedlich Desinfektionsmittel riechen und sich anfühlen können, und wie viel davon die Haut an meinen Händen verträgt, bis sie einen roten Ausschlag entwickelt (zunehmend mehr, der Körper gewöhnt sich). Ich weiss inzwischen auch Bescheid über die Mortalitätsrate und Übersterblichkeit. Über die Bedeutung von Aerosolen und den Wert eines guten Contact Tracings. Ich habe mir das Händewaschen nach dem Gang zum Briefkasten angewöhnt, und mich darauf eingestellt, den Weg zum Bahnhof zu Fuss zu gehen, statt den überfüllten Bus zu nutzen. Ich kann locker eine Handvoll Virusvarianten aufzählen. Alles Dinge, die ich eigentlich nicht können, nicht wissen wollte. Wissen, das man nicht brauchen dürfte.
Gleichzeitig gibt es Dinge, die mir noch immer nicht in den Kopf gehen. Warum sich Menschen nicht schützen wollen vor einer potentiell tödlichen Erkrankung, zum Beispiel, wenn dieser Schutz problemlos verfügbar und kostenlos zu haben ist. Muss man die Leute wirklich zu ihrem Glück zwingen? Oder warum so viele mit der Maske nur ihr Kinn bedecken. Sieht das cooler aus? Macht so viel Todesverachtung einen besonders guten Eindruck beim anderen Geschlecht? Ich verstehe auch nicht, wie man einen Impfstoff als etwas Unnatürliches ablehnen kann, zugleich aber in Kauf nimmt, dass man unter Umständen auf einer Intensivstation mit rund zwanzig höchst synthetischen und absolut nicht nebenwirkungsarmen Medikamenten vollgepumpt werden muss – über Wochen, vielleicht gar Monate. Von den Kandidaten, die es lieber auf eigene Faust mit Pferde-Entwurmungsmitteln versuchen wollen und sich so ihre Leber zerstören, ganz abgesehen.
Ich staune über den Fanatismus, den in diesen Fragen einige entwickeln. Die Paranoia. Darüber, wie sich manche in einem Freiheitskampf wähnen, dabei geht es ihnen offensichtlich nur um ihre persönliche Freiheit, ihr Leben ohne jede Rücksicht auf andere weiterzuleben … als gäbe es die Pandemie nicht. Verdrängung, Überforderung? Dummheit, Böswilligkeit? – Wenn es jemand als die grösste Zumutung seines Lebens empfindet, die halbe Stunde im Zug eine Gesichtsmaske zu tragen, was kann man dem noch sagen? Wie wird so jemand mit den ganz anderen Zumutungen fertig, die das Leben früher oder später auch für ihn bereithalten wird?
Am meisten staune ich, dass es eine egoistische, wissenschaftsfeindliche Minderheit und die Politik mit einem halben Jahr Untätigkeit und grenzenlosem Vertrauen ausschliesslich in das Prinzip Selbstverantwortung geschafft haben, dass wir jetzt wieder am selben Punkt stehen wie vor einem Jahr – nur schlimmer.
Mittwoch, 2021-10-06 | 0:29:16 CET
Die Geschichte des »Wüstenplaneten«, des Romans von Frank Herbert aus dem Jahr 1965, ist eine verwickelte. Die Kurzfassung ist, dass sich das komplexe, mit Ideen vollgestopfte Werk bis anhin jeder brauchbaren filmischen Umsetzung entzogen hatte. Der Roman ist nicht nur schlicht zu umfangreich, um sich halbwegs auf gängige Kinofilmlänge stutzen zu lassen, sondern strotzt auch nur so vor erklärungsbedürftigen Konzepten und Begriffen, sowie inneren Monologen der Hauptfiguren, die eine filmische Umsetzung anspruchsvoll machen. Ein erster Anlauf fiel schon in Trümmer, bevor es richtig losging – »Jodorowsky's Dune«, eine sicher interessante Dokumentation, die ich leider noch nicht sehen konnte, zeugt davon.
Dann kam Lynch … und scheiterte 1984 am Stoff [1], und das so arg, dass man den Altmeister heute besser nicht mehr darauf anspricht, und er seinen Namen im Zusammenhang mit »Dune« nicht mehr genannt sehen will. Ich finde ja, der Streifen ist unterbewertet und besser als sein Ruf: er versagt dabei, die Geschichte konsistent zu erzählen, um die es eigentlich geht, und glänzt auch nicht immer bei den Effekten. Was aber stark ist, ist das Produktions-Design: die Lynch-Fassung findet immer wieder prägnante Bilder, die die Fremdartigkeit der Zukunft, in der »Dune« spielt, gut vermitteln. Der Zufall will es, dass ich die Version von 1984 im zarten Alter von 13 oder 14 Jahren (so etwa um die Zeit muss es gewesen sein) zu sehen bekam, und mit dem Verständnis der Story zwar nicht hinterherkam (muss nicht nur an mir gelegen haben), aber von einigen Szenen so fasziniert war, dass sie mir ein Leben lang geblieben sind. Mit dem halb verunglückten Lynch-Streifen war die Saat gesät, und nur wenige Jahre später habe ich dann den Roman gelesen, ich meine zweimal, jetzt kürzlich dann, Jahrzehnte später, zum dritten Mal.
So habe ich diesen Stoff, oder zumindest ein paar Fetzen und Bilder davon, mein Leben lang mit mir herumgetragen, und konnte die Faszination für den Wüstenplaneten nie ganz abstreifen. Wie viele andere habe auch ich stets gehofft, dass es noch einmal eine gelungenere filmische Umsetzung geben würde, die nicht nur in sich geschlossener und technisch besser, sondern auch näher am Buch ist. Die Geduld wurde arg strapaziert: jetzt endlich, im Jahr 2021, ist eine ansehnliche Fassung zu bestaunen [2], und der Held, der es geschafft hat, ist Denis Villeneuve, der schon mit »Arrival« [3] einen hervorragenden Job gemacht und auch bei »Blade Runner 2049« [4] weitgehend überzeugt hatte. Ein talentierter Mann! Neulich konnte ich die Neuverfilmung endlich sehen (nicht, ohne noch vorher zur Auffrischung den Roman zu lesen), und habe das Fazit eigentlich schon verraten: ja, der Film ist gut und sehr sehenswert.
Aber vielleicht erst noch ein paar Worte zum Roman. Es wäre zwar wohl vergeblich, den Inhalt hier zusammenfassen zu wollen; man muss zuerst einmal nur wissen, dass er in einer sehr fernen Zukunft spielt, in der sich die Menschheit über viele Planeten ausgebreitet hat, die von verschiedenen Fraktionen (Häusern) beherrscht werden. Die Computertechnologie ist ausgemerzt worden, aber interplanetare Raumfahrt in gigantischen Schiffen existiert: hier hat die Raumfahrtgilde das Monopol, deren Vertreter nur mit Hilfe einer deshalb sehr kostbaren Droge durch Raum und Zeit navigieren können, dem »Gewürz« (Spice). Diese wichtige Substanz wird einzig auf einem ansonsten sehr kargen und gefährlichen Wüstenplaneten gewonnen (welcher eigentlich Arrakis heisst, genannt »Dune«), der deshalb heiss umkämpft ist. Daneben gibt es einen geheimnisvollen Frauenorden, eine Art Kult, der die Geschicke der Menschheit zu lenken versucht. Vor diesem Hintergrund ist der »Wüstenplanet« eine Abenteuergeschichte mit Schlachten und Intrigen, gleichzeitig der Entwicklungsroman des jungen Paul Atreides, der zu einer Art Erlöserfigur wird. Das alles wird garniert mit einigem esoterischen Hokuspokus über Konzentration und mentale Kräfte, sowie die wundersamen Wirkungen des »Spice«, der Droge, um die sich vieles dreht. Die Sechziger, kann man da nur sagen! Das alles könnte ein hinreissend schlechtes Buch abgeben, wenn der »Wüstenplanet« nicht so reich an interessanten Einfällen und so sprachgewaltig wäre. Herbert hatte keinen Aufwand gescheut, eine glaubhafte Welt zu erfinden, mit einer eigenen Ökologie und zahlreichen Details zu den Religionen und Gebräuchen, so etwa den Ritualen der Ureinwohner des Wüstenplaneten, der Fremen (diese sind menschlich, aber es bleibt offen, wie sie dorthin gelangt sind). In diesem Erfindungsreichtum kann der Roman sicher mit dem von Tolkien mithalten.
Auch wenn einem das Messianische und Psychedelische suspekt und die Abhandlung über Kolonialismus und die Ausbeutung von Ressourcen auf Kosten von Ureinwohnern einer fremden Welt zu wenig unterhaltsam sind: man kann den Roman mit grossem Gewinn lesen und wird nicht gelangweilt. Bei der erneuten Lektüre kürzlich, im Alter jenseits der Mitte vierzig, habe ich doch gestaunt, wie gut geschrieben und auch immer noch zeitgemäss dieser Brocken ist.
Wo überzeugt nun Villeneuves Film? Zunächst schon einmal mit der geglückten Besetzung vieler zentraler Rollen. Oscar Isaac als Leto Atreides: absolut perfekt. Exakt so muss der Mann aussehen, und genau dieses Bild hatte ich Jahrzehnte lang im Kopf. Er ist der Herzog. Überraschend anders, als ich sie mir vorgestellt hatte, vielleicht einen Tick zu jung, aber interessant und ganz grossartig in der Rolle der Lady Jessica: Rebecca Ferguson. Die perfekte Mischung aus der Strenge der Bene Gesserit und Verletzlichkeit einer sich sorgenden Mutter. Toll! Unerwartet blass hingegen bleiben Bardems Stilgar und Ramplings ehrwürdige Mutter Gaius Helen Mohiam (hier hat es nicht geholfen, dass ein Schleier ihr spannendes Gesicht verbirgt), aber das schadet dem Film nicht allzu sehr. Dazu die Kulissen: wow. Die Effekte: auf der Höhe der Zeit. Technische Schwierigkeiten wie eine glaubhafte Darstellung der Körperschilde (eigentlich eine Art Kraftfelder), oder der »Ornithopter« (kurz »Thopter«) genannten Hubschrauber-artigen Fluggeräte: gemeistert. Insgesamt das Produktionsdesign: nicht ganz so mutig wie das bei Lynch, aber eindrucksvoll und aus einem Guss. Man kann also viel Gutes sagen über Villeneuves Werk. Auch er hadert mit dem Umfang des Stoffs, musste ihn raffen, war aber vor allem mutig genug, den Roman in zwei Teile zu teilen und nur aus dem ersten den vorliegenden Film zu machen. Auch wenn es auf den Werbeplakaten nicht deutlich wird: es liegt hier nur Teil eins vor, und ich kann nur hoffen, jemand gibt ihm das Geld für einen ebenso guten Teil zwei. Der Schnitt erfolgt nach dem Duell, das Paul Atreides die Aufnahme bei den Fremen sichert.
Nicht ganz überzeugt hat mich, ausgerechnet, eben jene Hauptfigur, Paul Atreides. Spötter sagen, Timothée Chalamet wirke eher wie ein verwöhnter Musterknabe aus der Pariser Oberschicht als ein streng erzogener Thronfolger und tougher Kämpfer. Zu makellos, zu weich, zu sehr der Schönling. Dennoch kein schlechter Schauspieler, und die Visionen, die ihn ereilen, die nimmt man ihm ab.
Was nur teilweise gelungen ist, sind Dehnung und Raffung des Stoffs: der Film nimmt sich die Zeit, die verschiedenen Charaktere gründlich einzuführen, was ein Luxus und grosser Gewinn ist, muss dann aber den Teil bis zum Ausbruch des Krieges mit den Harkonnen recht zügig erzählen, und lässt dabei notgedrungen auch einige wichtige Szenen weg. Kaum ist der Umzug nach Arrakis geschehen, den man nur in wenigen groben Pinselstrichen dargestellt bekommt, rumpelt es schon und der Feind steht vor den Toren. Als Zuschauer, der den Roman vielleicht nicht gelesen hat, vermisst man die Diskussion des Plans des Barons Harkonnen, die dieser mit seinem Berater führt. Der warnende Brief mit der versteckten Botschaft, den Jessica im Roman in dem geheimen Gartenraum findet, die Szene fehlt. Fehlen tut damit auch das permanente Gefühl der Bedrohung durch Fallen und Meuchelmörder: die Szene mit dem Attentat per »Jägersucher« und dem eingemauerten (!) Bösewicht, der diesen fernsteuert, kommt recht kurz. Manche Figuren, die durchaus interessant wären, sterben ihren Tod, bevor sie einen zweiten Satz sagen konnten (Shadout Mapes). Dafür dass ein wichtiger Teil der Geschichte so flott erzählt wird, zieht es sich dann im zweiten Teil wieder deutlich in die Länge. Aber was will man sagen, es ist halt auch nicht einfach … das gebohrte Brett ist nun mal ziemlich dick, da kann man es als Regisseur vermutlich nie recht machen.
Wenn wir schon gerade beim Herummäkeln sind – mir ist wie vielen anderen unklar, wieso Liet Kynes plötzlich eine Frau sein soll – was eigentlich so keinen Sinn ergibt, wenn man die Rolle dieser Figur und die Kultur der Fremen, wie sie im Roman beschrieben ist, versteht.
Aber Schwamm drüber, das ist alles Jammern auf sehr hohem Niveau. Mich hat der Film glänzend unterhalten und keineswegs enttäuscht, im Gegenteil: er lässt die Mängel der Lynch-Fassung vergessen und sorgt für neue, einprägsame Bilder, die ich fortan mit mir herumtragen werde.
Wer bis hier gelesen hat, der hat genügend Interesse am Thema und das Sitzfleisch, auch den aktuellen »Dune« mit seinen zweieinhalb Stunden Laufzeit (für die erste Hälfte des Buchs) durchzustehen. Auf, in's Kino!
[1]  https://www.themoviedb.org/movie/841-dune
https://www.themoviedb.org/movie/841-dune
[2]  https://www.themoviedb.org/movie/438631-dune
https://www.themoviedb.org/movie/438631-dune
[3]  https://www.themoviedb.org/movie/329865-arrival
https://www.themoviedb.org/movie/329865-arrival
[4]  https://www.themoviedb.org/movie/335984-blade-runner-2049
https://www.themoviedb.org/movie/335984-blade-runner-2049
Ich glaube ich hätte dort bleiben sollen
Montag, 2021-09-13 | 22:49:50 CET

Modernes Retail-Banking [FINANCE POST]
Sonntag, 2021-08-22 | 23:55:59 CET
Die Herausforderung: als Kunde mit Domizil im Ausland ein Girokonto bei einer deutschen Direktbank eröffnen, um geerbte Gelder bei zwei anderen Instituten zusammenzuführen und von dem neuen Konto regelmässig anfallende Kosten für eine Immobilie zu bezahlen. Das Problem: viele deutsche Banken nehmen aus Prinzip keine Kunden mit Domizil im Ausland an. Die, die es theoretisch täten, tun es aus einer Reihe möglicher Gründe (der genaue Grund bleibt ein Geheimnis) dann manchmal trotzdem nicht. Ist man in der »glücklichen« Lage (eben etwa durch Erbschaft) elektronischen Zugang zu einem bestehenden Konto zu erhalten, ist man mit erstaunlichen Stolpersteinen und Unzulänglichkeiten konfrontiert.
Story 1: Kandidat 1, eine der wenigen Banken, die Kunden mit Domizil im Ausland (angeblich) akzeptieren und nicht von vorne herein ablehnen, dazu mit gratis Kontoführung (wenn man eine lange Reihe von Bedingungen erfüllt, darunter einen regelmässigen Zahlungseingang, sonst kostet es ein paar Euro im Monat – für mich OK, bin ich bereit zu zahlen). Kontoeröffnungsantrag online auszufüllen versucht, bei der Erfassung des Domizils auf ein viele Seiten langes PDF verwiesen, das man stattdessen ausfüllen und mit physischer Post senden soll – dazu einige weitere Formulare, die man selbst zusammensuchen darf. Alles gemacht und versendet, nächster Schritt Identifizierung via PostIdent in einer deutschen Postfiliale. Gemacht, brav Originale meiner letzten Strom- und Steuerrechnung (zwecks Nachweis der Domiziladresse) mitgenommen wie verlangt, mit denen die Dame bei der Post aber nichts anzufangen weiss. Sie macht keine Kopien, ich muss dann einen Scan per Email nachreichen, wieder von der Schweiz aus. Alles erledigt, die Sache geht endlich ihren Gang. Eine Woche später Post, ein generischer Standardbrief: Kontoeröffnungsantrag abgelehnt, keine konkreten Gründe, nur eine Liste von Kandidaten, schlechter Schufa-Eintrag zum Beispiel, aber die hat mich gewiss nicht in den Akten. Nachfragen und Bitten bleiben erfolglos, man will mich (mein Leben lang nie arbeitslos, stets schuldenfrei, bester Leumund, für deutsche Verhältnisse hervorragend verdienend, selbst Bankangestellter) einfach nicht. Man könnte es fast persönlich nehmen. Wenn ich raten müsste? Zu komplizierter Kunde, zu wenig an mir zu verdienen, Compliance-Aufwände zu hoch, Doppelbürgerschaft verdächtig … was weiss ich. Es mag am Korsett aktueller Regulierung liegen, oder an einer schlichten Aufwand/Ertrag-Rechnung.
Story 2: Eine zweite Bank führt das Sparkonto meiner verstorbenen Mutter und gibt mir etwa fünf Monate nach entsprechender Information und Beibringen aller nötigen Dokumente (Sterbeurkunde, notariell beglaubigte (!) Passkopie etc.) und mehrfachem Nachfragen doch noch Zugriff auf dieses Konto, das dann auch auf mich übertragen werden kann und jetzt unter meinem Namen läuft. Der Login gestaltet sich nicht ganz einfach, selbst für mich als technik-affinen studierten Informatiker – was war noch einmal der Unterschied zwischen der Online-PIN und der eBanking-PIN? Wieso benötige ich noch zusätzlich einen numerischen Key, und muss mich mit einer TAN-Liste herumschlagen? Auch im Schweizer Banking ist wirklich nicht alles Gold was glänzt, aber das erinnert mich doch an den technischen Stand in der Schweiz vor zehn Jahren. Wie auch immer, der Login ist geschafft – nun lockt die Option »Girokonto eröffnen«, um nebenbei vielleicht obiges Problem zu lösen. Dann würde ich als Kunde bleiben. »Eine Eröffnung eines weiteren Kontos ist für Sie nicht möglich.« Gut, dann muss ich mir einen anderen suchen. Vielleicht sollte ich das Sparkonto leeren und schliessen. »Konto löschen« heisst die Option, aber die ist nur verfügbar, wenn ein Referenzkonto hinterlegt ist. Das zuletzt hinterlegte (meiner Mutter) ist automatisch entfernt worden. Fair. Mein Schweizer Konto hinterlegen kann ich jedoch nicht: aus Sicherheitsgründen darf man das Referenzkonto nur alle 30 Tage ändern, und die von der Bank selbst ausgelöste Entfernung des vorherigen Referenzkontos zählt als Änderung. Die Suche nach einer Kommunikationsmöglichkeit mit dem Institut führt zunächst nur zu einem AI-Chatbot: »Um ein Sparkonto zu löschen, hinterlegen Sie ein Referenzkonto. Hat Ihnen diese Antwort geholfen?« – mein »Nein« verunsichert ihn nicht. Am Ende finde ich doch eine Möglichkeit, der Bank eine Nachricht zu senden – für das Abschicken braucht man allen Ernstes eine TAN. Am nächsten Tag erreicht mich eine Email: »Sobald Ihr Extra-Konto gelöscht ist, bekommen Sie Ihren Abschlussauszug von uns. Der ist auch gleichzeitig Ihre Löschungsbestätigung. Sie möchten sofort einen Haken dahinter haben? Dann nehmen Sie das einfach gleich selbst in die Hand: Log-in Banking > Meine Konten > Extra-Konto > Mehr > Konto löschen« … die offenbart, dass man meine Nachricht nicht wirklich gelesen hat, in der ich ihnen erklärt hatte, dass mir dieser Weg nicht offen steht, weil sie selbst kürzlich das vorherige Referenzkonto gelöscht haben. Jetzt warte ich darauf, dass das Geld auf meinem Schweizer Konto eintrudelt.
Story 3: Bei einem dritten Institut gibt es ein Girokonto, auf dass ich etwas schneller Zugang erhalte – das sich aber »leider nicht umschreiben lässt« und nach wie vor auf meine Mutter läuft. Der Login-Dschungel ist ganz ähnlich, wenn nicht schlimmer; man jongliert mit vier oder fünf verschiedenen Codes, Passwörtern und Identifiern, aber dazu mit einem alten und einem neuen eBanking. Nahezu jede Aktion in den beiden eBanking-Lösungen braucht eine Bestätigung auf einer speziellen App, die man aber leider, einmal installiert, nie mehr auf ein neues Handy verschieben kann, ohne den Support zu bemühen. Kontobewegungen sieht man nur innerhalb eines eng eingegrenzten Zeitraums, Kontoauszüge als PDF kann man »elektronisch bestellen«, stehen dann »frühestens am folgenden Bankarbeitstag zur Verfügung«. Uff, Steinzeit, und genug Grund, dort gar nicht dauerhaft Kunde werden zu wollen. Zurück zum Ausgangsproblem, »finde eine Bank« …
Fassen wir zusammen: für Deutschlands »beste Bank« [1], die »Bank neu denken« will, bin ich als Kunde nicht attraktiv genug, um auch nur ein banales Girokonto ohne Dispo eröffnen zu dürfen. Man lernt das erst nach einem ellenlangen Eröffnungsprozess, die Gründe bleiben streng geheim, zweiseitige Bettelbriefe bleiben selbstredend erfolglos. Bei Deutschlands »beliebtester Bank 2021« [2] (Warum sind das eigentlich zwei verschiedene Institute? Lieben die Leute nur den Zweitbesten?) hingegen bin ich zwar geduldet (wenn auch nicht für ein Girokonto), aber mit zahlreichen anderen Unzulänglichkeiten und Stolperfallen konfrontiert. Der Dritte im Bunde [3] macht keine viel bessere Figur, konfrontiert einen mit einem ähnlichen Login-Dschungel wie Kandidat 2 sowie unterhaltsamen anderen Macken (und zwei alternativen Online-Banking-Lösungen), aber war bislang zumindest nicht aktiv feindselig. Die Suche nach einem günstigen Girokonto in Deutschland für mich als auslandsdomizilierten Doppelbürger geht weiter. Bliebe zu wünschen, dass künftige Regulierung auch günstigen Anbietern wieder mehr Luft lässt, Kunden tatsächlich anzunehmen. Einsehen müssen wird man auch, dass die alleinige Konzentration auf die billigsten Konditionen nicht der Weg in die Zukunft sein kann. Vielleicht spielt ja die Service-Qualität doch eine Rolle …? Ich sehe mich für die sehr einfache Dienstleistung, die ich benötige, mehrere hundert Euro im Jahr berappen.
[1]  https://www.comdirect.de/
https://www.comdirect.de/
[2]  https://www.ing.de/
https://www.ing.de/
[3]  https://www.sparda-n.de/
https://www.sparda-n.de/
Sonntag, 2021-08-01 | 23:52:09 CET
Happy Birthday, Schweiz! – Neu ist der hiesige Nationalfeiertag auch meiner. Aber während mich das sehr freut, geht mir das damit verbundene Getöse von Feuerwerk eigentlich noch gleich auf den Geist wie schon immer, seit ich hier lebe. Vor allem, wenn man ein paar Fanatiker in der Nachbarschaft hat, die jeweils ein paar hundert Franken in Rauch aufgehen lassen. Könnte man nicht auch auf Drohnen wechseln, oder einfach still seine Fahne an's Balkongeländer hängen …?
Sonntag, 2021-04-11 | 22:21:13 CET
Damit wir auch noch einmal über etwas anderes als gebrochene Hände und nervraubende Pandemien gesprochen haben: das Matterhorn ist ein fast magischer Berg, dem kaum ein Foto gerecht werden kann, schon gar kein lumpiges aus dem Handy. Gewaltig!

Wer hätte gedacht, dass mich dieser Anblick so zu fesseln vermag. Wo immer man in Zermatt steht oder geht, das Matterhorn überragt alles und raubt einem den Atem, mehr als die FFP2-Maske. Das war die eher umständliche Anreise und alle Sicherheitsmassnahmen (Selbstversorgung im Apartement mit Kitchenette, Maskentragen nahezu überall, komplette Vemeidung der allgegenwärtigen Zermatter Elektro-Taxis usw. usf.) mehr als wert.
Mittwoch, 2021-03-31 | 22:17:14 CET
Dieser Text wird etwas kürzer als angedacht ausfallen – schreibt es sich doch einhändig eher umständlich, wenn man sich die linke Hand gebrochen hat. Und diese kleine Vorrede setzt auch schon den positiven Grundton des Rückblicks auf das erste Quartal 2021 (und ein Jahr Corona). Nebenbei: Leser mit gutem Gedächtnis werden sich erinnern, dass ich mir vor gar nicht so langer Zeit schon mal eine Hand gebrochen hatte. Damals war es allerdings die rechte.
Blicke ich auf die letzten zwölf Monate zurück, ist das Auffälligste daran, dass mir dazu gar nicht viele herausragende Ereignisse einfallen – ein Effekt der vielen gleichförmigen Home Office- und »Lockdown light«-Wochen, die grau und rasend schnell an einem vorüberziehen. Der erfolgreiche Abschluss meines Einbürgerungsverfahrens, der unerwartete Tod meiner Mutter, ein schöner Urlaub in Flims GR, ein gelungener Geburtstag – ansonsten ein Brei, die vielen neuen Pandemie-Erfahrungen, über die man gar nicht mehr viel reden mag (das Desinfizieren des Schreibtischs im Büro, der Thrill einer wagemutigen Busfahrt mit anderen Menschen, …), mal ausgeblendet. Und dann eben der Sturz vom Fahrrad am Montag, tja …
Gelernt habe ich jedenfalls, dass die Arbeit überwiegend von zuhause aus, alleine in der eigenen Stube, auf Dauer eben doch ziemlich an einem nagt. Der Hauch von Freiheit und Abenteuer der ersten Monate ist eher schnell verflogen, und virtuelle Meetings sind nunmal kein Ersatz für echte. Auch das ewige »you're on mute!« oder »mein Webex klemmt, ich logge nochmal neu ein« ist dann nach dem tausendsten Mal nicht mehr ganz so amüsant.
Man wird reizbarer, Disziplin und Konzentration werden auf eine Probe gestellt, die Arbeit erscheint entrückt, irgendwie abstrakt, gelegentlich auch sinnlos. Andererseits schön: der kurze Arbeitsweg, oder dem Paketzusteller mal die Tür persönlich öffnen zu können.
Ich wäre dann trotzdem froh, mich wieder mal vor Ort in der Bank über die Nervensäge vom benachbarten Schreibtisch ärgern oder mit Museums- oder Kinobesuchen Abwechslung in mein Leben bringen zu können, statt mit ungeplanten Saltos vom Fahrrad. Dann werden die Monate auch wieder bunter.
Sonntag, 2021-02-28 | 23:59:52 CET
… und die Diskussionen sind noch immer dieselben; lockern oder nicht, öffnen schneller oder langsamer, kommt die nächste Welle oder nicht, wo und warum klemmt's beim Impfen … und noch immer sitze ich mehrheitlich im »Home Office« und fahre, wenn ich doch im Büro bin, entgegen meinen sonstigen Gewohnheiten mit dem Auto, um die S-Bahn zu vermeiden. Es ist zum verzweifeln. Fast exakt vor einem Jahr ging der Wahnsinn hier so richtig los, und gar zu schnell vergisst man, was in der Zwischenzeit auch erreicht worden ist. Hoffen wir, dass nicht noch ein Jahr vergehen muss, bis so halbwegs wieder eine Form von Normalität einzieht.
Donnerstag, 2021-01-07 | 0:06:24 CET
Man könnte meinen, der Drehbuchschreiber des Sequels zu »2020 – Jahr der Schrecken« übertriebe es ein wenig. Irgendwie hatte man sich ja doch an die (klar, naive) Hoffnung geklammert, es würde alles besser werden. Das ist vorerst nicht so: die Pandemie wütet schlimmer denn je, die anlaufenden Impfungen bieten erst einmal nur ein wenig Hoffnung. Dazu zeigt sich in den letzten Tagen, aber vor allem heute, dass der oberste Brandstifter im Weissen Haus lieber die Hütte anzündet, als seinen Platz mit Anstand zu räumen. Sehr düstere Stunden in Amerika, deren Bilder lange nachwirken werden.
Da kann man nur mit etwas Verspätung sagen: Happy New Year
Sonst alles prima, danke der Nachfrage.